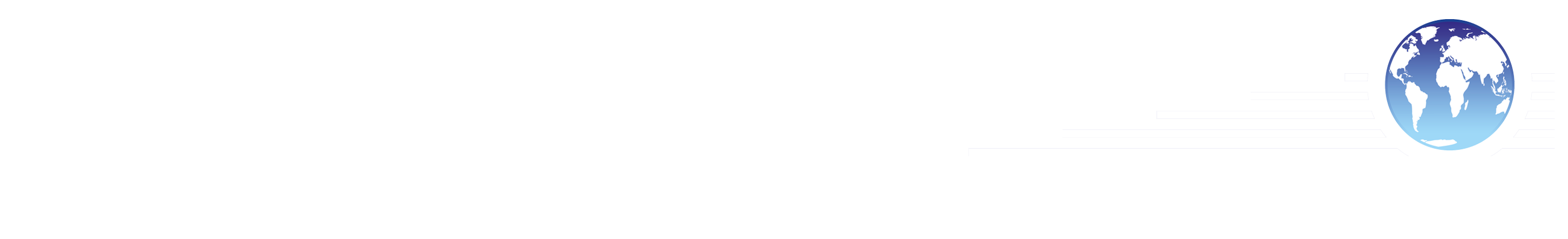- Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
- info@dr-rath-foundation.org

Internationales Tribunal bezichtigt Monsanto des ›Ökozids‹
April 25, 2017
Neue klinische Übersichtsarbeit erkennt in Sonnenschutzmitteln die Ursache für weit verbreiteten Vitamin D-Mangel
Mai 9, 2017Aufsichtsbehörden der Brüsseler EU ignorieren unverhohlen die Giftwirkungen von Pestizid-Cocktails in Nahrungsmitteln

Breitspurig verkündet ein aktueller Bericht der Brüsseler EU, die Pestizidgehalte von Lebensmitteln in Europa würden die so genannten Grenzwerte nicht übertreffen. Basis des Reports ist eine Analyse von mehr als 84 000 Proben. Davon ausgehend heißt es irreführend, in über 97 Prozent der Untersuchungen lägen die chemischen Rückstände noch innerhalb der in der Brüsseler EU zulässigen Mengen. Wohlweislich ausgeblendet werden aber die sich verstärkenden toxischen Wirkungen, sobald mehrere Pestizide nebeneinander vorliegen. Da solche Kombinationen leider der Regelfall sind, ist der Bericht offenbar als gesundheitliche Propaganda zu verstehen – dazu gedacht, die Öffentlichkeit über die Schädlichkeit von Insektiziden hinwegzutäuschen und entsprechend erzeugte Nahrungsmittel als sicher darzustellen.
Herausgeber des Reports ist die EFSA, die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit. Getestet wurden Produkte wie Auberginen, Bananen, Brokkoli, natives Olivenöl, Orangensaft, Erbsen, Paprika, Weintrauben, Weizen, Butter und Eier. Dabei lag das Augenmerk auf insgesamt 774 verschiedenen Chemikalien. Um es vorweg zu nehmen: Rückstände fanden sich in Nahrungsmitteln aller Kategorien. Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit aber noch besorgniserregender ist, dass der Bericht geflissentlich die Tatsache übersieht, dass die Pestizide beim Verzehr dieser Produkte nicht isoliert in unseren Körper gelangen, sondern miteinander wechselwirken. Der schädliche Einfluss dieser synthetischen Stoffe steigert sich mithin gegenseitig.
Immer mehr Belege für die Schädlichkeit von Chemikalien in unserer Nahrung

Ein Forschungsprojekt aus Dänemark ist wenig geeignet, die Sorgen um die allgemeine Gesundheit zu zerstreuen. Wie eine Veröffentlichung von 2015 zeigt, sind die Effekte verschiedener chemischer Substanzen, welche über die Nahrung in unseren Organismus gelangen, bedeutend schädlicher als bislang angenommen. Im Wissen darum, dass wir diese Schadstoffe nicht einzeln, sondern als Cocktails zu uns nehmen, führten Forscher des Nationalen Nahrungsmittelinstituts an der Technischen Universität Dänemark ihre Untersuchung durch. Dabei fanden sie heraus, dass bereits kleine Mengen von giftigen Substanzen, wie etwa Pestizide oder polychlorierte Biphenyle (PCB), ausreichen, um sich in Kombination miteinander in ihrer negativen Wirkung zu verstärken.
Die Ergebnisse aus Dänemark bestätigen damit im Grunde Bedenken, die wir vor mehr als einem Jahrzehnt hinsichtlich der Herangehensweise der Codex Alimentarius Kommission der Vereinten Nationen erstmalig äußerten: dass die starre Festsetzung von vermeintlich sicheren Obergrenzen von Pestizidgehalten in der Nahrung ein falsches Vorgehen ist. Ein Zugrundelegen der Codex-Grenzwerte – so wie es von der Welthandelsorganisation praktiziert wird, wenn es um Streitigkeiten bei Nahrungsmitteln geht – lässt somit von vornherein jene kumulativen Effekte unter den Tisch fallen, welche sich jedoch zu Lasten der Gesundheit unzähliger Verbraucher besonders auf längere Sicht ergeben, da verschiedene Pestizide gemeinsam auftreten und sich außerdem anreichern können. Eben diesen Fehler begeht auch der aktuelle Bericht seitens der Brüsseler EU, und es ist durchaus kein Zufall, dass dieselbe Institution im Interesse der Agrar- und Chemie-Lobby seit mehr als einem Jahrzehnt auf den Codex-Konferenzen den Ton angibt.
Die Vorzüge eines Umsteigens auf Bio-Lebensmittel

Glücklicherweise deuten andere Forschungsergebnisse darauf hin, dass es möglich ist, die Pestizidbelastungen unseres Körpers zu reduzieren. Eine Studie aus den USA aus dem Jahr 2015 zeigte, dass ein Umstieg von konventionell erzeugtem Obst und Gemüse auf ökologisch erzeugtes schon binnen weniger Tage die Pestizidgehalte im Körper erheblich senkt. Untersucht wurden 40 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Durchgeführt wurde die Arbeit am Zentrum für Umweltforschung und Gesundheit von Kindern, einer Einrichtung an der Kalifornischen Universität in Berkeley. Die Wissenschaftler verzeichneten infolge der Ernährungsumstellung auf Bio-Basis eine Minderung unterschiedlicher Pestizidwerte. Bezogen auf die Ausgangskonzentrationen betrug der Rückgang zwischen einem Viertel bis zur Hälfte. Die Beobachtungen decken sich mit Resultaten anderer Untersuchungen. Sie alle bilden eine lange Kette von Nachweisen über die gesundheitlichen Vorteile eines Umstiegs auf biologisch erzeugte Lebensmittel.
Wie Dr. Rath in der Erklärung von Barletta darlegt, ist es unumgänglich, die willkürlich errichteten Barrieren zwischen Ernährung und Gesundheitsversorgung niederzureißen, wenn wir ein tatsächlich auf Vorbeugung ausgerichtetes Gesundheitswesen schaffen wollen. Gleiches gilt für die Schranken zwischen Medizin und Landwirtschaft. Die vorsätzliche Aufrechterhaltung dieser Denk- und Informationsblockaden steht im krassen Widerspruch zum Nutzen für die Menschen dieser Welt. Motiviert wird diese künstliche Trennung einzig durch die wirtschaftlichen Vorteile der Pharmaindustrie, der Chemiebranche und des Biotech-Sektors. Sie alle profitieren skrupellos am Fortbestand dieses Betrugsgeschäfts – sei es anhand des Verkaufs von Medikamenten, von Ackergiften, künstlichen Nahrungsmittelzusätzen oder infolge einer Monopolisierung mithilfe gentechnisch manipulierter Organismen.
In nicht allzu ferner Zukunft wird es, unterstützt durch für alle Menschen zugängliche Gesundheitsbildungsprogramme, unweigerlich dazu kommen, dass der Öko-Landbau die spritzmittelintensive Agrarindustrie ersetzt. Der hemmungslose Einsatz von giftigen Chemikalien wird abgelöst werden von Anbaumethoden, die dem allgemeinen Bewusstsein der Verbraucher über die gesundheitliche Bedeutung von Mikronährstoffen Rechnung tragen. Bis dahin werden die Brüsseler EU, Codex Alimentarius und andere internationale Behörden zweifellos damit fortfahren, uns weismachen zu wollen, Pestizidrückstände in Nahrungsmitteln seien harmlos. Doch ebenso wie beim Pharma-Investmentgeschäft mit der Krankheit werden jene Institutionen gewiss auch für diese Handlungsweisen in den kommenden Jahren zur Verantwortung gezogen werden.